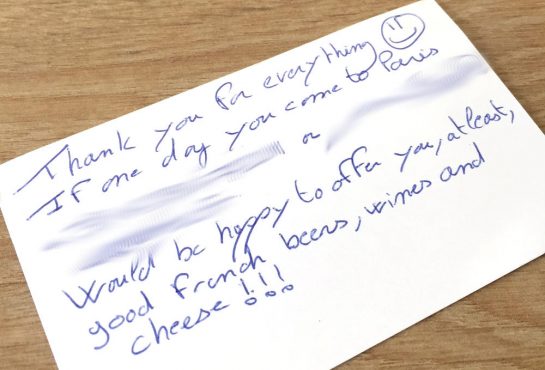Wie ich 16 Stunden lang einen Menschen beim Leiden anfeuerte
Ausflug nach Hamburg | In meinem letzten Beitrag setzte ich einen Cliffhanger, und es ist nun an der Zeit, von meinem Ausflug nach Hamburg zu erzählen. Anlass der Reise: Herr Stör hatte sich vorgenommen, dreieinhalb Kilometer in der Alster zu schwimmen, danach 180 Kilometer Fahrrad zu fahren, direkt im Anschluss einen Marathon zu laufen und Ironman von Hamburg zu werden. Seine erste Langdistanz. Wenn man seine gesamte Triathlon-Historie einbezieht, kann man sagen, dass er dafür sieben Jahre trainiert hat; in den vergangenen zwölf Monaten besonders eifrig.
Wer seinen Körper 226 Kilometer in kleinen und großen Kreisen – unangenehm vielen Kreisen – durch eine Stadt bewegt, braucht Freunde, die am Rand stehen und ihn anfeuern. Also fuhren der Reiseleiter und ich nach Hamburg, um Herrn Stör beizustehen, gemeinsam mit seiner Liebsten.
Die ganze Sache begann unangenehm früh, nämlich morgens um sechs, als die Profi-Damen starteten. Kurze Zeit später ließ sich auch Herr Stör zu Wasser – gemeinsam mit seinem Freund Olli, der ihn im Training begleitet hatte.

Wir beobachteten den Start per Tracking-App aus der U-Bahn und waren rechtzeitig am Platze, als unser Athlet nach eineinhalb Stunden aus der Alster stieg, leicht vertüdelt, so schien es. Obwohl wir grölten und winkten, bemerkte er uns nicht. Hinterher erfuhren wir, dass es ein beschwerlicher Schwumm war, bei dem er sich sogar kurz an einem DLRG-Boot festklammern musste, um eine kleine Panik wegzuatmen, hervorgerufen durch Freiwasser und Gedrubbel.
Wir gingen zur Wechselzone, aber als wir dort anlangten, saß Herr Stör schon auf dem Rad und fort war.
An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass ein Ironman auch für die Begleitmannschaft eine langwierige Angelegenheit ist. Nicht nur, dass wir früh aufgestanden sind, um Herrn Stör nach dem Schwimmen zu empfangen – die anschließende Radausfahrt dauerte 6 Stunden und 45 Minuten. Es ist eine ernsthafte Aufgabe, diese Zeit einerseits gut zu vertrödeln, andererseits aber auch Kräfte zu sparen. Wir haben schließlich alle noch einen Marathon vor uns.
Es war also ungefähr 9 Uhr, als Herr Stör uns in Richtung Geesthacht davonfuhr. Wir gingen erstmal frühstücken. Ein gutes Verpflegungsregime ist ein maßgeblicher Teil der Renntaktik, deshalb aßen wir reichlich, darunter auch Blaubeerpfannkuchen. Anschließend gingen wir zum Jupiter am Hamburger Hauptbahnhof, „das einzige Kaufhaus, das dich reicher macht“. In einem ehemaligen Karstadt-Kaufhaus stellen Künster und Künstlerinnen ihre Werke aus, es gibt Theater, Workshops und ein Café. Eine recht spannende Angelegenheit; einige Kunstwerke gefielen mir ausnehmend gut, andere passten zum Thema des Tages.




Die Graffitis gehören zur Ausstellung Female Frames, die den weiblichen Blick auf Graffiti zeigt. Die Künsterlinnen stammen aus Portugal, Litauen, Indien, Kolumbien und Deutschland.
Vom Dach des Jupiter aus hatten wir eine gute Aussicht auf die Rennstrecke vor der Stadtbibliothek. Wir gingen hinunter und standen tatsächlich parat, klatschten und riefen, als unser Athlet an uns vorbeifuhr. Doch wieder sah er uns nicht.

Wie wir dort standen, entdeckten wir, dass die Stadtbibliothek geöffnet hatte. Wunderbar! Wir gingen hinein, und ich las die ersten 50 Seiten von Elizabeth Strouts „Am Meer“ – ein Buch, das ich mir anschließend in der Bahnhofsbuchhandlung kaufte. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch kurz in den wirklich gemütlichen Sesseln einnickten. Als wir uns wieder aufrafften, waren wir jedenfalls etwas hüftsteif und musste erstmal wieder zurück ins Rennen finden.
Ungefähr bei der 90-Kilometer-Marke, so erzählte Herr Stör später – wir mussten zwischen Jupiter und Bibliothek gewesen sein -, habe er an einem Penalty-Zelt angehalten und den Helfern dort gesagt, dass es jetzt genug sei und er aufhören wolle; ihm täte alles weh, das könne so nicht weitergehen. Die Helfer hätten mitfühlend genickt und geantwortet, dass das schon nachvollziehbar sei, dass das aber alles in allem kein Grund sei aufzugeben. Er solle bitte einfach weiterfahren; er könne ja an jedem weiteren Zelt wieder anhalten und es sich neu überlegen, aber hier bei ihnen – nein, das sei unangebracht. Also fuhr er weiter, noch einmal 90 Kilometer, bis er wieder in der Wechselzone war und offiziell absteigen durfte.
Dort warteten wir auf ihn – wir hatten gerade einen Sandwich verdrückt, um neue Kräfte zu finden -, und schauten ihm beim Umziehen zu. Er fragte uns, wie er jetzt noch einen Marathon laufen solle. Das wussten wir auch nicht; diese ganze Veranstaltung war uns ohnehin ein Rätsel, also sagten wir: „Ach, das schaffst du schon!“ Dann gingen wir an die Lombardsbrücke, die Binnen- und Außenalster trennt. Dort kamen die Athleten in jeder Runde viermal vorbei – vier Gelegenheiten anzufeuern.
Wie sich herausstellte, war das auch dringend nötig, denn nach den ersten drei Marathonkilometern lief Herr Stör nicht mehr, er ging nur noch spazieren. Was los sei, fragten wir. Er könne nicht mehr laufen, antwortete er, es ginge einfach nicht mehr, überhaupt sei das alles eine Schnapsidee gewesen, er wolle aufgeben, das habe alles keinen Zweck mehr, er schaffe das sowieso nicht. Er wirkte etwas weinerlich – ein Zustand, zu dem er allen Grund hatte, der aber zu diesem Zeitpunkt unangemessen war, schließlich hatte er schon mehr als 188 Kilometer und damit mehr als achtzig Prozent der Strecke zurückgelegt. An den restlichen 38 Kilometer durfte es jetzt nun wirklich nicht scheitern. Wir sprachen ihm wohlmeinende Worte zu. Als er um die nächste Kurve verschwand, holten wir unseren Taschenrechner heraus und kamen – auch für uns überraschend – zu dem Ergebnis, dass er, wenn er mit sechs Kilometern pro Stunden weiterspazieren würde, noch vor der Cut-Off-Zeit von 15 Stunden 30 ins Ziel käme. Es gab also keinen Grund zur Eile, es war noch alles drin! Als er wieder vorbei kam, teilten wir ihm diese Erkenntnis mit. Er wirkte nicht überzeugt, aber immerhin etwas gelöster.
Das nachfolgende Bilddokument zeigt den Athleten und seinen Kumpel Olli beim Spazierengehen an der Alster.

Nun kommt der Punkt, an dem die Erzählung deutliche Längen hat, aber nun ja, das liegt in der Natur der Dinge.
Wir hielten die Stellung an der Lombardsbrücke. Jedesmal, wenn Herr Stör an uns vorbeikam, fragte er: „Wie viel Uhr ist es? Wie viel??“ Wir sagten es und gleich dazu, dass er absolut on track sei; er solle einfach weitergehen, immer weiter. Möglicherweise rechnete er während des Spazierengehens nach und kam zum gleichen Ergebnis; oder er konnte nicht mehr rechnen und glaubte uns einfach – jedenfalls ging er und ging und ging. Eine Runde. Noch eine Runde.
Die Menge der Läufer wurde kleiner und kleiner, auch die Zuschauer dünnten sich aus. Wir kannten irgendwann jeden, der noch auf der Strecke war: Nigel und Michael, dann der Österreicher im Kostüm und die Britin im gelben Oberteil. Wir feuerten sie alle an. Jemand rollte Flatterband zusammen. Die Sonne senkte sich über die Strecke hinab. Verpflegungsstände wurden abgebaut. Die Laternen gingen an. Der Mond ging auf. Es begann, nach Nacht zu riechen. Unser Athlet spazierte.

Es war gegen 22 Uhr 10, als Herr Stör das letzte Mal an uns vorbeimarschierte. „Weitermachen, einfach weitermachen!“, riefen wir. „Zweineinhalb Kilometer noch!“ Er wirkte jetzt ganz frohgemut, sein Gang war fast wippend.
Wir machten uns in Richtung Rathaus auf, während Herr Stör noch eine Schleife lief. Vor dem Rathaus der Zieleinlauf: Musik, Lichtkegel, klatschende Menschen. Die Rathausuhr zeigte zwanzig vor elf, als unser Athlet die Glocke bimmelte und die letzten Metern über die Linie lief – ja, tatsächlich: lief.
Kurz nach ihm zündeten Menschen Wunderkerzen an und sangen: „In Hamburg sagt man Tschü-hüs …!“ Der Ironman Hamburg 20024 war vorbei. Herr Stör raschelte rhythmisch mit der ihm umgehängten Aludecke.

Am nächsten Tag erfuhren wir: Herr Stör ist Letzer geworden. Der Allerletzte: Platz 2.330 von 2.330 Menschen, die rechtzeitig ins Ziel gekommen sind. 15 Stunden und 27 Minuten, drei Minuten vor der Cut-Off-Zeit. Er ist ein Ironman.